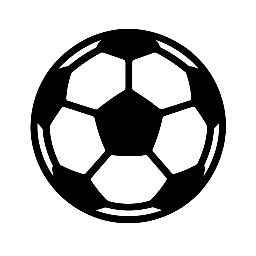Ganz im Sinne der Grounded Theory wächst und verändert sich diese Arbeitsgliederung im Verlauf des Forschungsprozesses. Auch die Unterkapitel können sich in Aufbau und/oder Inhalt unterscheiden, da immer wieder Anpassungen und Innovationen sowie neue Erkenntnisse hinzukommen.

Support Your local Soccer Sociologist!
Unterstütz mich in meinem Herzensprojekt Fußball-Soziologie und mach bei meiner laufenden Befragung mit.
1 Einleitung: Liebe, Glaube, Leidenschaft!
1.1 Projektidee und erste Forschungsfragen
1.1.1 Fußball und LEIDENschaft
1.1.2 Polyamorie: leide und verteile!
1.1.3 Affekte und Affektkontrolle
1.2 Methodischer Rahmen: KI Meets Grounded Theory
1.2.1 Warum Grounded Theory
1.2.2 KI: Sternstunde der qualitativen Sozialforschung?!
1.2.3 Der Autor: vom Fan zum teilnehmenden Beobachter
1.2.4 Die Suche nach idealtypischen Fans / Fankulturen
1.2.4.1 Sportgeneralist:innen
1.2.4.2 Liebeskranke:r
1.2.4.3 Ultras
1.2.4.5 Hooligans
1.2.4.6 Expert:innen
1.2.4.7 Erfolgsfans
1.2.4.8 Polyamore
1.2.4.9 Politisch und sozial Motivierte
1.2.4.11 Fantourist:innen
1.2.4.12 Traditionalist:innen
1.2.4.13 Amateurspieler:innen
1.2.4.14 Vereinslokalist:innen
1.3 Zum Laufenden Auf- und Ausbau des Projekts
2 Grundlagen & Theorie
2.1 Affekt und Affektkontrolle
2.2.1 Affekte: Egal, was auch immer passiert, wir lieben dich sowieso!
2.2.2 Affektkontrolle: zwischen Regelwerk und Entgrenzug
2.2.3 Affekte als Dreh- und Angelpunkt des Projekts
2.2 Theoretisches Rüstzeug
2.2.2 (Sozial-)Psychologische Grundlagen
2.2.2.1 Freud und Jung: Fußball als Bühne für Triebe und Archetypen
2.2.2.2 Theorien des sozialen Vergleichs: Warum wir jubeln, wenn die Anderen weinen.
2.2.2.3 Kognitive Dissonanz: Warum wir auch nach Abstiegen treu bleiben
2.2.2.4 Reaktanz: Warum wir gegen Regeln rebellieren
2.2.2.5 Impression Management: Die Inszenierung von Fankultur
2.2.3 Klassiker der Soziologie
2.2.3.1 Elias/Dunning und die kontrollierte Entgrenzung
2.2.3.2 Dahrendorf: Jedes Spiel ist ein aufgeladener sozialer Mikrokonflikt
2.2.3.3 George H. Mead: Play and Game
2.2.3.4 Tönnies: Fußball zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft
2.2.3.5 Piketty: Das Kapital im Fußball des 21. Jahrhunderts
2.2.3.6 Durkheim: Kollektive Ekstasen
2.2.3.7 Simmel: Humor, (Selbst-)Ironie und Wechselwirkungen
2.2.3.8 Eribon: Männlichkeit, Klassenkampf und Homophobie im Fußball
2.2.3.9 Goffman: Über die Vorder- und Hinter(tri)bühnen
2.2.3.10 Weber: Zweckrationalisierung von Affekten
2.2.3.11 Systemtheoretische Zugänge, Luhmann / Parsons
2.2.3.12 Affekte im Kontext von Handlungstheorie & Rational Choice
2.2.3.13 Frei nach Putnam: Corona oder Watching Soccer Alone
2.2.3.14 Giddens: Die Strukturierung von Affekten
2.2.3.15 Habermas: Ein erster Blick auf das Konzept der Gegenöffentlichkeit
2.2.3.16 Rosa: Resonanz und Affektbeziehungen
2.2.3.17 Ulrich Beck: Unsicherheiten auf dem Spielfeld
2.2.3.18 Wenn das Geld Tore schießt: Bourdieu und der Einfluss des Kapitals
2.2.3.19 Wahnsinn! Wachen und Bestrafen mit Foucault
2.2.3.20 Jutta Allmendinger: Warum jedes Spiel ein Konzert auf der Genderklaviatur ist.
2.2.3.21 Armin Nassehi: Eine Spiel- und Stilktritik der großen Geste
2.2.3.22 El Classico: Marx und die Verfremdung des Fußballs vom Fan
2.2.3.23 Eric Olin Wright: Soccer & Shmoos
2.2.3.24 Norman Braun: Zwischen der Rationalität und dem Irrationalen
2.2.3.25 Nochmal Coleman und der Königsweg soziologischer Erklärung
2.4 Der Ball ist Rund und das Spiel dauert 90 Minuten und Am Ende…
2.5 Die dunkle Seite des Sports
2.5.1 Aus der Suchtforschung: Wenn der Ball süchtig macht.
2.5.2 Sportwetten: ein sportlicher Abstieg
2.5.3 Alkohol und andere Drogen
2.5.4 Doping nicht für die Gefühle
2.6 Ebenen der Affektkontrolle
2.6.1 Mikro: Selbst- und Gruppenregulation
2.6.2 Meso: Vereins- und Verbandsregeln
2.6.3 Makro: Politik, Ökonomie, Recht
2.6.4 Zusammenfassung Makro-Mikro-Meso
2.7 Zusammenfassende Gedanken für die Empirie: Die Welt des Fußballs, der Fußball in der Welt als Spiegel der Gesellschaft?!
3 Theoriebrücken und Erweiterungen: You Never Walk Alone!
3.1 Resonanz und eröffnete Räume
3.2 Kapital, Habitus und das (Spiel-)Feld
Zwischenstopp Kommerzialisierung: Ökonomische Barrieren als Zugangshürde
3.2.1 Der Kapitalismus im Fußball des 21. Jahrhunderts
3.2.2 Ökonomisches Kapital
3.2.3 Humankapital
3.2.4 Soziales Kapital
3.2.5 Symbolisches und kulturelles Kapital
3.2.6 Momente der Ausbeutung im modernen Fußball
3.2.7 Die feinen Unterschiede in den Idealtypen: Wer ist von Fan von Was und Wem?
3.3 Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeiten ums Spielfeld herum
3.3.1 Konzept der Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit
3.3.2 Soziale Gegenöffentlichkeiten
3.3.3 Migrantische Gegenöffentlichkeiten
3.3.4 Feministische Gegenöffentlichkeiten
3.3.5 Queere Gegenöffentlichkeiten
3.3.6 Dekolonialisierte (Gegen-)Öffentlichkeiten
4 Empirie & Fallstudien: „…was dieser Verein seinen Fans zumutet!“
4.1 „Der Club is a Depp“ – Der Code der Gefühle
4.2 Unsere Codes der Affekte und Gefühle
Einblicke in den laufenden Kodierprozess
4.3 Regionale Verwurzelung und Protestkulturen
4.3.1 FC Nürnberg – Lokalpatriotismus, regionale Identität & Affektökonomie
4.3.2 FC Nürnberg U23 – Jugendfans, Übergänge & Nachwuchskultur
4.3.3 FC Nürnberg Frauen – Sichtbarkeit, Genderrollen und Ressourcen
4.3.4 SSV Jahn Regensburg – Regionalität, Stadt- und Land-Fankultur & Geschlechterrollen
4.3.5 SpVgg Bayreuth (Oldschdod) – Lokale Tradition, subkulturelle Identität
4.3.6 Zusammenfassung
4.4 Queere und feministische Gegenöffentlichkeiten
4.4.1 FC St. Pauli – Queer-feministische Fanszenen & linke Gegenöffentlichkeit
4.4.2 Bohemians Dublin – Subkulturelle Fankultur & Solidarität
4.4.3 Brøndby IF – Skandinavische Integration & Genderrollen
4.4.4 AS Saint-Étienne – Arbeitertradition & weibliche Beteiligung
4.4.5 Hapoel Tel Aviv – Politik, Religion & queere Unsichtbarkeit
4.4.6 In den Farben getrennt, in der Sache vereint: die Norisbengel und der QFF
4.5 Der Ball ist rund wie die Welt: Internationale und globale Perspektiven
4.5.1 IFK Göteborg – Gendergleichheit & soziale Gleichheit in Skandinavien
4.5.2 Crystal Palace – Klasse, Gentrifizierung & Stadionkultur in London
4.5.3 FC Bologna – Ultras, Politik & Inklusion / Exklusion von Frauen/LGBT
4.5.4 FC Südtirol – Sprachliche Minderheiten, Identität & Geschlecht
4.5.5 Urawa Red Diamonds – Globalisierte Fankultur & transnationale Fans
4.5.6 Orlando Pirates – Race, Ethnicity & Queer Counter Publics
4.6 Euer Hass ist unser Stolz: Eine historische Würdigung des FC Bayern
4.6.1 Selbstreflexion: Wenn ein Glubberer über die Bayern schreibt…
4.6.2 Widerstand im Dritten Reich
4.6.3 Kommerzialisierung
4.6.4 Der FC Bayern als deutscher Fußball in der Welt
4.7 „Ich überlebe diese Liebe nicht!“ Mein Leben mit dem Club als Depp
4.7.1 Selbstreflexion: Kein ganz kleiner Bub mehr
4.7.2 In den ersten Jahren als Fan vom Aufstieg bis zum Abgrund
4.7.3 Verdrängung
4.7.4 Frauenfußball und Polyamorie als Lösung
4.7.5 Ein Buch wird geboren
4.8 Exkurs Corona und die A(E)ffekte
5 Wo Geld noch keine Tore schießt: Nationalsportart Hurling
5.1 Die finanzielle Regulierung von Sport in Irland
5.2 (Un-)Sinn der Gehaltsgrenzen im irischen Profi-Fußball
5.3 Wie Sport (fast) ohne Geld funktioniert: Hurling
5.4 GAA Galway Hurling: Tradition, Camogie & geschlechtliche Parallelkulturen
6 Getrennt in den Farben, vereint in der Sache: Synthesen & Diskussion
7 Theoretical Coding und affektive Ökonomien
7.1 Empirische Quellen: Einordnung und Beurteilung
7.1.2 Interviews und Expert:innen-Befragung
7.1.3 Pressespiegel und Pressekonferenzen
7.1.4 Vereinsseiten, Fanzines und Fanseiten
7.1.5 Teilnehmende Beobachtung im Stadion
7.1.6 Teilnehmende Beobachtung an anderen Orten
7.1.7 Reflexion und Forschungstagebuch
7.2 Offenes, axiales und selektives Kodieren im Projekt
7.3 Affekte als Ressourcen und Währungen
7.4 Kontrolle als Strukturprinzip
7.5 Gegenöffentlichkeiten und Zukunft des Fußballs
7.5.1 Feministische Perspektiven
7.5.2 Queere Perspektiven
7.5.3 Migrantische Perspektiven
7.5.4 Zusammenfassung: Diversität im Fußball
7.5.5 Nachhaltigkeit im Fußball
7.5.6 Digitalisierung und neue Formen der Fankommunikation
8 Theologischer Exkurs: Symbolische Dimensionen des Fußballs
8.1 Fußball als Ersatzreligion: Der steinige Weg des Hiob ins Paradies
8.2 Rituale und Choreografien
8.3 Symbolische Gemeinschaften und Transzendenz
9 „Fußball ist wie Schach – nur ohne Würfel“ ein Fazit
9.1 Zusammenführung von Theorie und Empirie
9.2 Perspektiven einer globalen, diversitätsbewussten Fußballsoziologie
10 Methodologische Reflexion
10.1 Abschließende Reflexion der teilnehmenden Beobachtung
10.2 Grounded Theory als Erkenntnispraxis
10.3 KI zur Auswertung qualitativer Daten
10.3.1 SWOT-Analyse zur Nutzung von KI im Projekt
10.3.2 Dauerproblem: Halluzinationen und unvollständige Tasks
10.3.3 Handson Empfehlungen für qualitative Folgeforschung mit KI
11 Anhang zu den Methoden
11.1 Kodier-Raster & KI Codes (JSON)
11.2 Interviewleitfäden & Beispieldaten
11.3 Dokumentation der verwendeten KI Skripte in JSON-Code
11.4 Tabellen/Abbildungen zu Codes, Vereinen und Theorien
Streichungen/Änderungen (teils auch verlinkt)
1.2.4.10 Purist:innen
3.3.1 Strukturwandel der Öffentlichkeit – normative Leitidee3.3.2 Exklusion von Frauen, Arbeiterinnen, Migrantinnen, queerer und anderer Minderheiten3.3.3 Inklusion und Exklusion: Regionale und transnationales Erleben von „Diaspora“3.3.4 Feministische und queere Gegenöffentlichkeiten3.3.5 Fanclubs als soziale Bewegungen
4 Empirie: Die Kurve als Diskursraum Von Affekten und Gegenöffentlichkeiten
4.1 Queer-feministische Perspektiven
4.2 Globale Soziologie und dekoloniale Ansätze
4.4.2 Habermas im Stadion: Öffentlichkeit zwischen Diskurs und Choreo 5.4.3 Fraser: Subalterne Counterpublics und queere Fankultur 5.4.6 Habermas/Fraser: Exklusion & Inklusion in der Subkultur 5.4.5 Musik, Kunst und Fankultur als alternative Öffentlichkeiten