
Die Erforschung von Affekten und Affektkontrolle, von Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeiten im Fußball erfordert ein dynamisches, partizipatives Forschungsdesign, das die Intensität individueller Erfahrungen mit den strukturellen Logiken des sozialen Systems Fußball verbindet. Fußball ist ein lebendiges affektives Ökosystem, in dem Mikro-Emotionen und Makro-Dynamiken in Echtzeit – 90 Minuten plus Nachspielzeit (auch vor und nach dem Spiel) interagieren. Ein klassisches Testen vorgetroffener Hypothesen wird meiner persönlichen Einschätzung nach dieser Komplexität. Es brauchten einen theoretischen sowie empirischen Ansatz, der im Verlauf der Forschung neue und zuvor nicht bedachte Phänomene aufgreift. Die Theorie entsteht iterativ – um im Bild zu bleiben – auf dem empirischen Spielfeld. Die Expertise der Fans (sowie der beteiligten Institutionen und deren Vertreter) sind elementarer Bestandteil des Forschungsprozesses. Zentral ist auch meine Position als teilnehmender Beobachter im Prozess, die es immer wieder im Spiegel des Forschungsgeschehens zu reflektieren gilt. Hebenstreit (2012) analysiert das Wechselspiel zwischen der Rolle des Forschers und der des Fans.
Grounded Theory als lebendiger, reflexiver Forschungs-Prozess
Die Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967; Charmaz, 2014) bildet das Rückgrat dieser Studie, weil sie Theoriebildung als dialogischen Prozess versteht. Wie Clarke (2012) betont, entsteht Theorie in einem Wechselspiel zwischen Daten, Forscher:in und Feld. Für dieses Projekt bedeutet das einen dreistufigen, partizipativen Kodierprozess:
(1) Offenes Kodieren mit Fan-Perspektiven
Die Datenbasis enthält neben Interviews auch Beobachtungen und Analyse von Fans generierter Inhalte (z.B. Social-Media-Posts, Fanzine-Artikel, Podcasts).
(2) Axiales Kodieren als kollektive Mustererkennung
Im Interview werden Fans stets als Co-Analyst:innen eingebunden. KI wird eingebunden, um größere Mengen an qualitativen Daten nach bestehenden, neuen, widersprüchlichen und affirmativen Codes zu durchsuchen. Versucht wird, die Codes und deren Wechselwirkungen jeweils der Mikro-, Meso- oder Makro-Ebene des Geschehens zuzuordnen.
(3) Selektives Kodieren mit Feedbackschleifen
Kernkategorien werden im und nach dem Austausch mit Fans und anderen empirischen Quellen entwickelt, z. B.:
- Affektive Eigenlogik: Warum sind bestimmte Emotionen in Kurven „erlaubt“ bzw. „geboten“ und andere „verboten“?
- Digitale Gegenöffentlichkeiten: Wie kreiiert Social Media neue Affekträume?
- Kommerzielle Affektlenkung: Wie vermarkten Vereine Emotionen?
- Validierung: Wie werden Ergebnisse und Entwicklungen rund um den Verein in Fan-Foren oder Stammtischen diskutiert?
Colemans Badewannen-Modell
Die Coleman-Badewanne (1990) dient als meta-analytischer Rahmen, um eben genau das Zusammenspiel der Mikro-, Meso- und Makro-Ebenen im Auge zu behalten.
Literatur
- Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory. Sage.
- Clarke, A. E. (2012). Situational Analysis. Thousand Oaks. Sage.
- Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Harvard University Press.
- Hebestreit (2012). Sozialwissenschaftliche Fußballforschung. Zugänge – Konzepte – Kritik In: Brandt (Hg.) 2012 – Gesellschaftsspiel Fußball. Wiesbaden. Springer. S. 19-37.
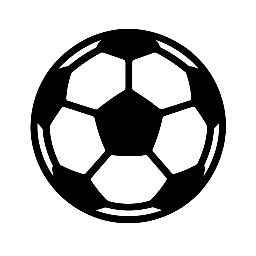
Schreibe einen Kommentar